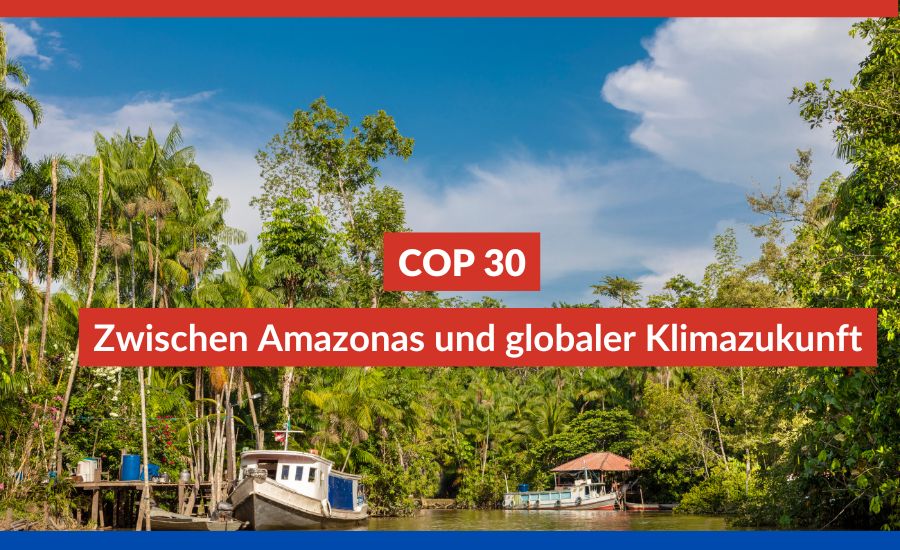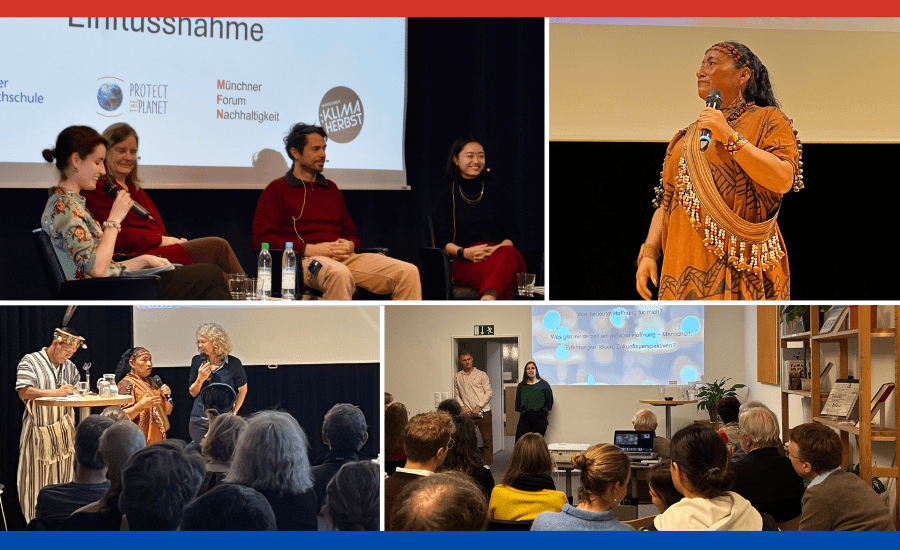Am Montag, den 10.11.2025 startet inmitten des Amazonas die COP30. Vom 10. bis 21. November 2025 diskutieren Regierungschefs, Wissenschaftler*innen, Klimaaktivist*innen und Vertreter*innen der Wirtschaft in der brasilianischen Amazonas-Stadt Belém über die Zukunft des Planeten und über Klimaschutz. Insgesamt nehmen über 190 Staaten teil.
Die „Conference of the Parties“ (COP) ist die jährliche Weltklimakonferenz im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC). Sie dient der internationalen Koordination bei der Reduktion von Treibhausgasen und der Anpassung an den Klimawandel. Die COP30 markiert ein besonderes Jubiläum: Zum ersten Mal seit dem Pariser Klimaabkommen wird ein umfassender „Global Stocktake“ durchgeführt – eine weltweite Bestandsaufnahme der bisherigen Klimaschutzanstrengungen. Dabei prüfen die Staaten, ob sie auf Kurs sind, ihre nationalen Beiträge (NDCs) einzuhalten, und wie sie ihre Ambitionen erhöhen können.
Die COP und das Pariser Klimaabkommen
Vor genau zehn Jahren wurde auf der COP21 in Paris das Pariser Klimaabkommen beschlossen – ein völkerrechtlich bindender Vertrag mit dem Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 bis 2 °C zu begrenzen. Doch davon ist die Welt noch weit entfernt. Der Weltklimarat (IPCC) warnt, dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 um durchschnittlich 3,2 Grad erwärmen könnte, wenn keine zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Die Studie der DMG und DPG kommt nun zu dem Ergebnis, dass 3 °C Welterwärmung im Jahr 2050 nicht mehr auszuschließen sind.
Gerade Industrienationen wie Deutschland tragen eine besondere Verantwortung, ihre Emissionen drastisch zu senken und verbindliche Fahrpläne für Klimaneutralität vorzulegen.
Ambitionierte Ziele inmitten globaler Herausforderungen
Ein zentrales Thema der COP30 ist die Bewertung des Fortschritts gemessen an den Zielen des Pariser Abkommens. Insbesondere steht die Frage im Fokus, wie Klimafinanzierung künftig gerechter und effizienter bereitgestellt werden kann – vor allem für Länder, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sind.
Darüber hinaus stehen auf der Agenda:
- die Transformation von Energie- und Verkehrssystemen,
- die Anpassung an extreme Wetterereignisse,
- die Bewahrung der Biodiversität im Amazonasgebiet sowie
- die Stärkung nicht-staatlicher Akteur*innen, etwa Städte und Regionen.
Die EU setzt ein schwaches Signal
Nur wenige Tage vor der COP30 in Brasilien standen die EU-Umweltminister unter erheblichem internationalen Druck, rechtzeitig ein verbindliches 2040-Ziel vorzulegen. Im Vorfeld der COP haben sie sich dann nach stundenlangen Verhandlungen in Brüssel auf ein Rahmenziel geeinigt: Bis 2040 sollen die Treibhausgas‑Emissionen im Vergleich zu 1990 um ungefähr 90 % gesenkt werden. Bei der Umsetzung sind jedoch Flexibilitäten vorgesehen:
Klimaschutzmaßnahmen können nun auch in Drittstaaten bis zu 5% auf die Zielerreichung angerechnet werden. Die geplante Einbindung des Wärme- und Straßenverkehrs in den Emissionshandel (ETS 2) wird von 2027 auf 2028 verschoben.
Die Abschwächung des europäischen Klimaziels geht auf die Sorge einiger Mitgliedstaaten zurück, dass stärkere Klimaschutzmaßnahmen Wirtschaft und Verbraucher finanziell überfordern könnten. Hinzu kommen neue politische Prioritäten infolge des Ukraine-Kriegs, etwa steigende Verteidigungsausgaben.
Entsprechend groß ist die Kritik von Umweltorganisationen – auch wir schließen uns dem entschieden an. Die Absenkung des 2040-Ziels ist ein Rückschritt für den europäischen Klimaschutz: Sie bedeutet effektiv weniger und langsameres Handeln in einer Zeit, in der jede Tonne CO₂ zählt. Noch schwerer wiegt jedoch das Signal, das davon ausgeht. Wenn selbst die EU, die sich lange als Vorbild für ambitionierte Klimapolitik verstanden hat, ihre Ziele abschwächt – warum sollten andere Staaten ihre Anstrengungen erhöhen? Gerade Länder, die wirtschaftlich noch stärker unter Druck stehen, könnten sich dadurch bestärkt fühlen, eigene Maßnahmen aufzuschieben. Damit droht ein Dominoeffekt, der den globalen Fortschritt beim Klimaschutz ausbremst.
Internationale Klimapolitik wirkt – aber sie braucht Tempo
Trotz aller berechtigten Kritik zeigen die bisherigen Klimaverträge Wirkung: Ohne die UNFCCC, das Pariser Abkommen und nationale Maßnahmen läge die erwartete Erderwärmung laut wissenschaftlichen Hochrechnungen heute bei bis zu 4 Grad.
Die COP30 ist deshalb mehr als nur eine Konferenz. Sie ist ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit internationaler Klimapolitik – und ein Appell, jetzt schneller, gerechter und entschlossener zu handeln.
Wie es weitergeht, wird sich auf der diesjährigen COP in Brasilien zeigen. Dort wird sich entscheiden, ob die Weltgemeinschaft den nötigen Kurs in Richtung Klimaneutralität hält – oder ob nationale Interessen den globalen Fortschritt weiter bremsen. Wer das Geschehen vor Ort mitverfolgen möchte, findet aktuelle Informationen und Einschätzungen unter anderem bei CAN International und CAN Europe auf Social Media. Auch wir begleiten die Entwicklungen und ordnen die Ergebnisse aus Sicht des Klimaschutzes ein. Abonnieren Sie gerne unseren Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben!